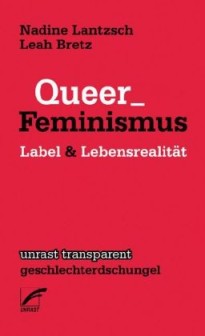 Leah Bretz und Nadine Lantzsch haben ein kleines, sehr lesenswertes Buch geschrieben, in dem sie ihre Praxis des Queer-Feminismus erläutern. Lesenswert fand ich es vor allem deshalb, weil sie dabei das machen, was meiner Meinung nach die Stärke feministischer Politik ausmacht: Sie gehen von sich selbst und ihren eigenen Erfahrungen aus, machen ihre Überlegungen nachvollziehbar, zeichnen die Debatten nach, in die diese eingebettet sind, beziehen sich auf andere, von denen sie gelernt haben, und kommen dadurch zu neuen Einsichten und Urteilen über die Welt, die sie nun wiederum mit anderen teilen.
Leah Bretz und Nadine Lantzsch haben ein kleines, sehr lesenswertes Buch geschrieben, in dem sie ihre Praxis des Queer-Feminismus erläutern. Lesenswert fand ich es vor allem deshalb, weil sie dabei das machen, was meiner Meinung nach die Stärke feministischer Politik ausmacht: Sie gehen von sich selbst und ihren eigenen Erfahrungen aus, machen ihre Überlegungen nachvollziehbar, zeichnen die Debatten nach, in die diese eingebettet sind, beziehen sich auf andere, von denen sie gelernt haben, und kommen dadurch zu neuen Einsichten und Urteilen über die Welt, die sie nun wiederum mit anderen teilen.
Auch wenn ich selbst mich ja nicht als queer verstehe, habe ich bei der Lektüre vieles verstanden und gelernt, was ich in den oft eher zerstückelten und schwer in bestimmte Kontexte einzuordnenden Hin und Hers in Blogs oder auf Twitter nur erahnt hatte. Vielleicht ist das „Buch“ als Format der längeren Texte zu einem Thema ja doch nicht ganz ad acta zu legen 🙂
Ein zentrales Anliegen dieses Buches ist die Sprache, die Art und Weise, wie und von wem über Dinge (nicht) gesprochen wird, was gesagt und gehört wird und was nicht. Dass Sprechen und Handeln nicht zweierlei Dinge sind, sondern dass Sprechen eben selbst eine Form des Handelns ist, finde ich auch (ich nenne das im Anschluss an italienische Feministinnen „Arbeit an der symbolischen Ordnung“).
Um etwas Neues zu sagen, das im Rahmen der vorherrschenden symbolischen Ordnung (noch) nicht denkbar und sagbar ist, braucht es auch eine andere Sprache, die Aufmerksamkeit für Formulierungen, die Erfindung neuer Sprachformen und neuer Wörter. „Entmerken“ und „wegnennen“ sind zum Beispiel zwei Wortschöpfungen, von denen ich mir gut vorstellen kann, dass sie in meinen aktiven Sprachgebrauch eingehen, ebenso die Verwendung des Unterstrichs, der hier nicht nur im Sinne des Gender-Gaps (wie bei „Leser_innen“) oder als wandernder Unterstrich („Les_erinnen“) auftritt, sondern auch, um den Sinn von Worten zu erweitern. „Be_deuten“ etwa schreiben die Autorinnen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Bedeutungen eben nicht einfach da sind („Das Wort X bedeutet dies und jenes“), sondern dass sie von den Sprechenden oder Schreibenden gegeben werden: Wir be_deuten Worte, indem wir ihnen durch die Art, wie wir sie verwenden, mit einer Bedeutung ausstatten, zum Beispiel „Frau“ oder „Lesbe“ oder „Liebespaar“).
Vor allem aber wird der Unterstrich in dem Buch dazu verwendet, die Ambivalenz und Mehrdeutigkeit auszudrücken, die in vielen Situationen teilweise_ganz notwendig ist, um bestimmte Dinge mitzudenken_schreiben_merken_w_orten. Anfangs ist das etwas merk_würdig zu lesen, aber nach einigen Seiten war ich „drin“ und es hat mir gefallen.
Besonders interessiert haben mich die Ausführungen zur Praxis, wobei mir beim Lesen klar geworden ist, warum vieles von dem, was die Autorinnen als „Interventionen“ beschreiben, oft auf so heftigen Widerspruch stößt. Eine Intervention, die sie vorschlagen, ist zum Beispiel „umverteilung ohne anerkennung“, was bedeutet, dass Menschen, die in bestimmten Kontexten privilegiert sind, dort notwendige Arbeiten übernehmen, dabei aber die Deutungs- und Definitionshoheit den anderen überlassen und keine Dankbarkeit oder Anerkennung für das, was sie tun, verlangen und bekommen (S. 32). Dahinter steht die traurige Beobachtung, dass selbst in Gruppen, die sich als kritisch, feministisch oder antirassistisch verstehen, die Privilegierteren oft dazu neigen, die Sache zu dominieren, es besser zu wissen als die anderen und so weiter.
Mich hat das von der Struktur her an eine Regel erinnert, die sich die Philosophinnengemeinschaft Diotima gegeben hat, nämlich bei ihren Diskussionen auf alle Zitate von „berühmten Philosophen“ zu verzichten – Chiara Zamboni beschreibt das in diesem Text. Auch hier ging es um einen konkreten Missstand, den die Beteiligten an sich selbst beobachtet hatten, in dem Fall, dass sich ihre Debatten häufig zu einer Ansammlung von „bereits Gedachtem“ entwickelten und sie nur selten ihre wirklich eigenen Gedanken aussprachen oder ihnen Aufmerksamkeit widmeten.
Beide Interventionen sind Vorschläge, in Form einer politischen Praxis, also durch bestimmte Regeln, eingefahrene Muster zu durchbrechen. Es geht nicht darum, universale Gesetze für alle Zeiten und für jeden x-beliebigen Kontext zu postulieren. Selbst gewählte Regeln, die Teil einer politischen Praxis sind, können sich bewähren oder auch nicht, das bleibt zu beobachten. Die Regel der Diotima-Philosophinnen etwa, auf Zitate generell zu verzichten, hatte tatsächlich zur Folge, dass die Diskussionen fruchtbarer und origineller wurden. Als die beteiligten Frauen nach einigen Jahren dermaßen daran gewohnt waren, ihre eigenen Gedanken zu formulieren und ernst zu nehmen, stellten sie fest, dass der absolute Verzicht auf Zitierungen gar nicht mehr nötig war. In anderen Gruppen und Kontexten kann eine solche Verabredung aber immer noch sinnvoll sein.
Dass Debatten über Vorschläge für Interventionen oder politischen Praktiken häufig so aggressiv ablaufen, scheint mir daran zu liegen, dass sie als allgemeingültige Vorschriften miss_verstanden und entsprechend auseinandergepflückt werden. Einwände wie „Sollen Frauen denn niemals mehr Männer zitieren, das ist doch absurd!“ oder „Sollen Weiße_Männer_etc.pp etwa ihre Meinung nicht mehr sagen dürfen, das ist doch absurd!“ gehen aber am Kern der Sache völlig vorbei. Die Frage ist vielmehr, ob zum jetzigen Zeitpunkt und beim gegenwärtigen Stand der Debatte eine solche (durchaus rigide) Regel hilfreich sein könnte, um einen Missstand zu beheben. Ob sie das ist, kann man nie vorher wissen, sondern man muss es erst einmal versuchen, um es herauszufinden. Und wenn andere mit einer Praxis gute Erfahrungen gemacht habe, was spricht dagegen, davon zu lernen – wenn einer an dem Thema wirklich gelegen ist?
Eine andere Sache, die mir beim Lesen im Kopf hängen blieb, ist die Frage, ob es wirklich „keine Welt außerhalb von Machtverhältnissen“ gibt, wie die Autorinnen schreiben (S. 35). Einerseits ja, sicher, denn wir sind unbestreitbar alle jederzeit in Machtverhältnisse verwickelt. Aber diese Machtverhältnisse sind eben nicht alles, wohinein wir verwickelt sind. Wir sind gleichzeitig – oder können es zumindest sein, wenn wir die Praxis vertrauensvoller Beziehungen pflegen – eingebunden in Kontexte, wo wir die Ungleichheit (vor allem, aber nicht nur, zwischen Frauen) zum Hebel für den Austausch von Begehren und Autorität und damit für Veränderung machen können. Dieser Aspekt kam mir in dem Buch etwas zu kurz, schien mir zu defensiv dargestellt, lediglich in seiner Funktion als Schutz und Abwehr gegen Diskriminierungen gewürdigt und nicht als originäre Politik, die die Kraft hat, Neues und Anderes hervorzubringen.
Vielleicht hängt dieser Eindruck damit zusammen, dass ich auch den (De)-Konstruktivismus nicht für die einzige Analysekategorie halte, die für politische Veränderungsprozesse wichtig ist. Die in der Realität bestehenden Machtverhältnisse zu dekonstruieren ist wichtig und unverzichtbar, keine Frage. Aber das, worum es geht, ist meiner Meinung nach nicht nur die Abwehr von Machtverhältnissen und der Abbau von ungerechten Diskriminierungen. Sondern es geht auch darum, „konstruktiv“ (haha) zu sein, also daran arbeiten, was denn an die Stelle der jetzigen Realität treten könnte, wenn die gegebene erst einmal „dekonstruiert ist“.
Ich bin, anders als die Autorinnen, der Ansicht, dass dafür die Orientierung an so etwas wie „der Wahrheit“ letzten Endes doch unverzichtbar ist. Und zwar gerade dann, wenn wir davon ausgehen, dass Politik immer eine pluralistische Angelegenheit ist, weil es nämlich zum Grundwesen der Menschen gehört, verschieden zu sein. Wenn wir aber alle verschieden sind, und es trotzdem am Ende um mehr gehen soll als darum, die eigene Position gegenüber den anderen durchzusetzen, brauchen wir einen Anhaltspunkt, einen Maßstab, an dem sich unsere kontroversen Debatten orientieren können_sollten_müssten.
Die Realität, die von bereits gegebenen Maßstäben, Kategorien und Be_deutungen geprägt ist, kann das nicht sein, da gebe ich den Autorinnen Recht. Aber ich denke, dass es hinter der „Realität“ noch etwas anderes gibt, das ich „das Reale“ nenne, und dass Interventionen_Worte_Stammeleien_Überlegungen_Ideen, die dieses Reale berühren, eine Wirkung entfalten (können), die mehr ist als bloße Macht_Stärke, Überzeugungskraft oder rhetorisches Geschick. Das Reale geht nicht vollständig in der gegebenen Realität auf, und deshalb ist es ein Orientierungspunkt bei dem Versuch, die Realität zu verändern.
Um es an einem Beispiel deutlich zu machen: „körper sind in unserem konstruktivistischen verständnis diskursiv hergestellte projektionsflächen für genderungen_disableisierungen_rassifizierungen“ schreiben die Autorinnen (S. 39), und das stimmt. Das ist die Realität. Aber Körper sind eben mehr als das. Körper sind auch real. Körper existieren, auch jenseits aller Konstruktionen und Zuschreibungen, und diese realen Körper, auch wenn sie niemals vollends „richtig“ be_deutet werden können, sind meiner Ansicht nach ein unverzichtbares Gegenüber, das unser eigenes kritisches Sprechen über Körper quasi beglaubigen kann. Worte und Handlungen, die das Reale berühren, haben eine Qualität von „Wahrheit“, die sie von anderen Worten und Handlungen, die bloße Ansichten und Meinungen sind, unterscheiden – jedenfalls sehe ich das so. Und etwas Analoges gilt auch für alle anderen Angelegenheiten, über die wir kritisch sprechen (möchten).
Leah Bretz, Nadine Lantzsch: Queer-Feminismus. Label und Lebensrealität, Unrast, Münster 2013, 7,80 Euro.
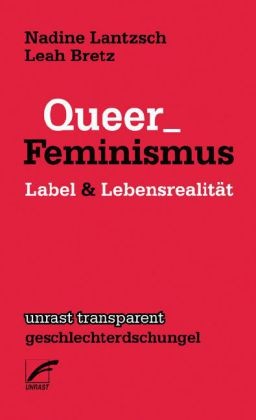
OMG. Wenn das Buch von Bretz&Lantzsch die angedeutete typographische Qualität hat, prophezeie ich dramatischen Erfolg in Bezug auf Nichtgelesenwerden. Schriftsprache derart brutal zu instrumentalisieren verletzt nicht nur ästhetisches Empfinden sondern verbrennt auch gleich noch Diskursbrücken im Dutzend. Es fällt mir als erklärt am Diskurs Interessierten und weißgott Sprachaffinen schon gelegentlich schwer, die gegender_gappten Texte hier im Blog in Gänze zu „genießen“. Wieso diese Aggression? Woher dieser Impuls, zu verletzen? Ich meine das ganz ehrlich. Mir tut „sowas“ weh.
LikeLike
@Papadopoulos – Äh – und woher kommt nun hier deine Aggressivität? Seit wann ist es aggressiv, ein Buch so zu schreiben, wie man es schreiben will und für richtig hält?
LikeLike
Danke für die „Einführung“. Das werde ich lesen.
Die Gefahr, das „Reale“, d.i. vor allem die Körper, das Körperliche, die damit verbundenen Erfahrungen (die konstruiert sind, ja, aber nur a u c h) weg zu de_konstruieren und damit noch einmal, schon wieder, überhaupt unsichtbar zu machen, die treibt mich auch immer wieder um. Und dennoch: Ich werde das lesen und bestimmt einiges lernen.
LG
LikeLike
@Antje: Meine Aggressivität? Dachte, ich hätte nur geschildert, wie ich den Umgang mit Sprache empfinde. Es ist nicht per se „aggressiv, ein Buch so zu schreiben, wie man es schreiben will und für richtig hält“. Aber die Wahl der Waffen (= Stilmittel) trägt in ihrer überkonsequent umgesetzten Ablehnung tradierten Kommunikationsstils durchaus aggressive Züge.
Möglicherweise bin ich auch einfach zu soft. Mist. 😉
LikeLike
Ich persönlich komme mit den vielen Unterstrichen auch nicht so wirklich klar… Und ich empfinde diese Art mit der Sprache umzugehen als unintuitiv und „unkünstlerisch-verkopft“.
LikeLike
„Seit wann ist es aggressiv, ein Buch so zu schreiben, wie man es schreiben will und für richtig hält?“
Sprache beruht auf Konsens. Sich diesem zu verweigern und den Lesern die eigene Privatschreibweise aufzunötigen, ist vielleicht nicht unbedingt aggressiv, aber wenigstens prätenziös.
LikeLike
@horst sabine – ja, und manchmal ist es eben nötig, um etwas Neues zu sagen.
LikeLike
Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Blogeintrag:
Wenn wir aber alle verschieden sind, und es trotzdem am Ende um mehr gehen soll als darum, die eigene Position gegenüber den anderen durchzusetzen, brauchen wir einen Anhaltspunkt, einen Maßstab, an dem sich unsere kontroversen Debatten orientieren können_sollten_müssten.
Das sagt auch nicht mehr aus als
Wenn wir aber alle verschieden sind, und es trotzdem am Ende um mehr gehen soll als darum, die eigene Position gegenüber den anderen durchzusetzen, brauchen wir einen Anhaltspunkt, einen Maßstab, an dem sich unsere kontroversen Debatten orientieren.
… oder?
Andere Leute lassen jeden Satz mit drei bis zehn Punkten enden, um Unbestimmtheit oder eine vage Suche auszudrücken.
LikeLike
@Papadopoulos 22. April 2013 –
Ich wechsele gern mein Tagesobst, mein Tagesgemüse, meine Nahrung, Körpernahrung – und ähnlich halte ich es auch gern (aber nicht laufend) mit der „Geistesnahrung“, wovon wohl Stilmittel der Sprache nicht die unbedeutendsten sein dürften.
So weit ich mich „erinnere“, denkt und spricht (oft auch: fühlt!) Geist in den Bildern der Sprache – meinst du nicht, Papadopoulos, man könnte sich auch auf viel seitige geist_es_köstliche „Nahrung“ einwechseln?
Nur Sushi kommt bei mir nicht in den Bauch, das zu m samme l ngerollte originäre SchiffslackAltÖlDüngerMedikamentenCocktailRezept aus den Ozeanen der Tankerwelten.
Auch für den Geist kein Sushi_gift (auch wenn sich das so anhört: gift ist zwar in der Anglistik ein Geschenk, aber im Deut schen geangelt eben nicht), und so manch ein blog ist halt nur Sush_i – dieser hier wohl eher nicht, denn:
Das erste Buch, das ich mir aufgrund einer Re Zension zulege, ist wohl das hier von Antje Schrupp beschriebene, womit auch die Rezension der Antje die erste ist, die es mir über zeugt, daß ich in diesem Buch kein Sush_i finde – hoffentlich.
Jedenfalls werde ich mich darauf einlassen, wohlgemerkt bitte korrekt lesen, nicht „ein lassen“ sondern „einlassen“ (etwa im Sinne von „reinlassen – jedoch nicht wie etwas „rein und sauber lassen“)
Für Antje Schrupp:
Konstruktivismus hin oder her, dem geht es auch nicht anders, als allen den vielgerühmten Nietzsche-Sprüchen: Sobald das Gesagte und Gemeinte auf das Gesagte selber angewandt wird, hebt es sich auf, verschwindet es in der Bedeutungslosigkeit der eigenen Selbstwidersprüche, Unverstehbarkeiten und der mit reichhaltigen Denkgirlanden und Bedeutungsrabatten geschmückten und verkleideten Zirkelschlüsse, ist es nicht queer sondern nur noch queer dekonstruiert.
So hoffe ich, in dem von Antje gepriesenen Buch solcherart friendly Sushi gift nicht obendrauf zu erhalten.
LikeLike
Sprache beruht einerseits auf Konsens und andererseits ist sie Veränderungen unterworfen. Woher sollen diese Veränderungen kommen, wenn es nicht kreative Versuche gibt, diese vorzuschlagen. Wer meint Sprache würde nicht akiv neugestaltet werden, unterschätzt die historischen Veränderungen, die beispielsweise durch den Buchdruck oder die Übersetzung der Bibel durch Luther stattgefunden haben. „Das Deutsche“ oder irgendeine andere Sprache gibt es nicht.
Die Schreibweise „be_greifen“ ist auch nicht wirklich neu. In den 80ern gab es viele Versuche die Bedeutung der Worte deutlicher zu machen, in dem der Bindestrich verwendet wurde: z.B. be-greifen. Somit steht diese Schreibweise auch in einer älteren Tradition.
Was die „Erfindung“ neuer Wörter angeht. Heute sprechen viele Menschen von „Erwerbslosen“ und verwenden diesen Begriff synonym für „Arbeitslose“. Tatsächlich ist dieses Wort von Feministinnen „erfunden“ worden, um sichtbar zu machen, dass „arbeitslose“ Mütter* genug zu tun haben und unbezahlte Arbeit leisten. Dass sie, wenn sie kein Erwerbseinkommen beziehen, eben erwerbslos sind aber nicht arbeitslos. Der Kontext ist heute vielen nicht mehr geläufig.
Oder ein „einfaches“ Beispiel heute sagen die allermeisten Menschen: „das macht keinen Sinn“. Genau genommen, heißt es aber „es ergibt keinen Sinn“. Ersteres ist quasi ein Anglizierung der deutschen Phrase, die inzwischen vollkommen selbstverständlich ist.
Alle die anderen, kreativen Schreibweise mit solcher Vehemenz entgegen treten (nach meiner Beobachtung besonders in bestimmten politischen Kontexten) ignorieren das Sprache ständig einem Wandel unterworfen ist. Wie dieser Wandel zustande kommt, hat sehr unterschiedliche Quellen.
Es fällt mir auf, dass im queer_feministischen Kontext die Kritiker_innen* besonders stark auf sprachliche Veränderungen reagieren. Das ist für mich eine Art sich an der Form abzuarbeiten und vom Inhalt abzulenken.
Für mich wird hier keine „Privatsprache“ verwendet, sondern die vorhandene Sprache kreativ verwendet, um Verwerfungen und Diskrepanzen sichtbar zu machen. Da Sprache als „Herrschaftsinstrument“ es oft den „Marginalisierten“ unmöglich macht, zu sprechen.
LikeLike
@Irene – ich finde, da ist ein Unterschied, genau das vage ist es, was mir _manchmal 🙂 gefällt. Denn ein Problem des heutigen mainstreamigen öffentlichen Sprechens ist es meiner Ansicht nach grade, dass so viele pauschalisierend „un-vage“ Behauptungen und „Thesen“ und Analysen etc. kursieren, sodass man sich dann über diese Böller streitet und gar nicht mehr differenziert sprechen kann.
Deshalb habe ich mich an dieser Stelle für den „vagen“ Dreiklang können_sollen_müssten entschieden, weil ich nicht einfach behaupten will, dass Debatten (immer prinzipiell) einen Maßstab brauchen (wobei man dann zu mir in die Talkshow eine pointierte Gegenposition einladen würde, die im Gegenteil behauptet, dass Debatten niemals und auf keinen Fall so einen Maßstab haben dürfen), sondern weil ich den Vorschlag, wir könnten_sollten_müssten so einen Maßstab haben ernsthaft in die Diskussion bringen möchte, auch wenn ich selbst dabei nicht hundertprozentig sicher bin.
Aber du hast recht, man sollte sich nicht prinzipiell und immer vage ausdrücken. Manchmal muss man auch klar was sagen, aber genau darauf, beides zu können und in einer konkreten Situation angemessen zu entscheiden kommt es mir ja an. Wie gesagt: Das Gegenteil ist genauso falsch.
LikeLike
Schließe mich Claudia an. Wenn all die Sternchen und Unterstriche, sowie aufzählende Schrägstriche noch angereichert sind mit queerfeministischem Fachvokabular („CIS-Männer“ etc.), dann geb‘ ich schon mal auf und klicke weg.
Ja, Sprache verändert sich – aber für mein Empfinden nicht durch militant wirkendes Zwingen-wollen, sondern da, wo die neue Form der Mehrheit als „das Passendere“ erscheint. Wie etwa „Sinn machen“ auch deshalb das „Sinn haben“ abgelöst hat, weil allgemeines Machertum Zeitgeist ist und man meint, stets alles im Griff zu haben oder zumindest haben zu sollen.
bzw.: ……das Macher_innentum Zeitgeist ist und eins meint, alles im Griff zu haben/haben zu können/haben zu sollen.
LikeLike
@Claudia – Naja, erstens hat die Mehrheit nicht unbedingt recht (wobei, klar, ob es sich durchsetzt, darüber entscheidet die Mehrheit, aber ich verwende zum Beispiel trotzdem inklusive Sprache, weil ich davon überzeugt bin, Mehrheit hin oder her). Und zweitens muss ja irgendjemand zunächst damit anfangen, bevor sich dann zeigen kann, dass die Mehrheit etwas übernimmt. Die Leute, die zuerst mit was anfangen, gelten immer als Spinner_innen, ob sie es wirklich sind, zeigt sich erst im Lauf der Zeit.
LikeLike
Zu deinem Kritikpunkt, dass es auch eine „Welt außerhalb von Machtverhältnissen“ gibt: Das finde ich gar nicht die problematische Frage: Letztlich kann man jede soziale Situation als durchzogen mit Macht interpretieren. Richtig problematisch wird es erst, wenn Macht Macht ist und hier kein Unterschied mehr gemacht wird. Wenn Begriffe kontextlos als „gewaltvoll“ gesehen werden und deren Zitieren als eine „unheimlich gewaltvolle“ Machtausübung begriffen wird, dann kann man nicht mehr sinnvoll darüber reden, wie gewaltvoll es ist, von Nazis zusammengeschlagen zu werden.
Das Problem ist also weniger, die Übernahme des Foucaultschen Machtbegriffes, sondern der Relativismus, alles was einem zuwider ist, in den selben Begriffen auszudrücken und damit über einen Kamm zu scheren.
LikeLike
Ich wundere mich immer wieder, wieviel reflexhafte Abwehr das Thema inklusive Sprache auslöst. Und das sogar unter den Leser_innen des Blogs von Antje Schrupp! Was ist denn da los? Ihr wollt euch mit einem Thema beschäftigen, aber es soll euch bitte bloß nicht zu nahe kommen. Ihr würdet schon gern was Kritisches lesen über die Ordnung der Gesellschaft, aber das darf bitte nicht so weit gehen, dass es in die gewohnte, automatisierte Wahrnehmung eingreift und womöglich in der Lage wäre, die eigenen Denkgewohnheiten aufzudecken. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Bequemlichkeit über alles.
LikeLike
Wenn ein Buch so geschrieben ist, werde ich es ganz bestimmt nicht lesen, auch wenn ich es verstehen könnte. Viele andere werden es nicht können.
Wenn die Autorinnen sich aber nur an Personen richten, die sowieso eine hohe Bildung haben und sich im feministischen Kontext einordnen, dann ist diese Schreibweise vermutlich gut und alle fühlen sich bestätigt. Es ist ein Buch von Gleichen für Gleiche, die Mehrheit wird sprachlich ausgegrenzt wie in vielen Diskussionen.
Schade finde ich das, da gerade von denjenigen es als so wichtig empfunden wird, mit Sprache nicht ausgrenzend zu sein, aber leider wird das nur auf das Geschlecht und nichts sonst bezogen. So eine Sprache ist für viel mehr Menschen ausgrenzend als vielleicht das generische Maskulinum.
Natürlich verändert sich Sprache, aber wenn Sprache so stark so zwanghaft von nur einer kleinen Gruppe verändert wird, dann spaltet es die Gesellschaft doch nur noch mehr, statt anderen irgendwas von Machtverhältnissen zu vermitteln, wird hier doch selbst Macht ausgeübt.
Es wird versucht eigene Sprache von oben auf alle zu drücken, auf Menschen, die damit aber gar nichts anfangen können.
Habe gerade auch einen Artikel geschrieben, der ein wenig am Thema der Sprache kratzt und das Problem verdeutlichen soll, dass man sich hier in einer eigenen Welt befindet, die eben nichts mit der Wirklichkeit von vielen zu tun hat:
http://nur-miria.blogspot.de/2013/04/meine-andere-welt.html
LikeLike
@Miria – nein, das stimmt nicht, die Sprache im diesem Buch ist nicht schwer zu verstehen, sondern nur ungewohnt. Man muss nichts Großartiges können oder Vorwissen haben, Neugier und die Bereitschaft, sich mal drauf einzulassen, reichen völlig.
LikeLike
@Antje: Ich kenne das Buch bisher nur aus deiner Rezension, kann also nicht mit Sicherheit sagen, wie die Sprache darin ist. Aber ich kenne Nadines Blog und finde schon dort die häufige Verwendung von Fachtermini nicht unbedingt einfach zu verstehen. Und ich bezweifel, dass sie in einem Buch darauf verzichtet.
Außerdem kannst du gar nicht beurteilen, ob etwas schwer zu verstehen ist oder nicht. Auch wenn es für dich einfach zu verstehen ist, weil du dich bereits auskennst und Vorwissen hast, so kann es dennoch für andere schwer zu verstehen sein.
Wie ich bereits schrieb empfinde ich es nichtmal unbedingt als negativ, dass etwas so geschrieben wird, dass es nicht von allen verstanden wird. Ich möchte einfach nur nicht, dass man dann sagt, man richtet sich an alle. Wenn klar ist, dass es sich um Fachliteratur für ein bestimmtes Klientel handelt, ist es doch ok.
Es ist eben ausgrenzend und das wollte ich deutlich machen, das ist alles.
Weißt du zufällig, ob es das Buch auch in Buchhandlungen zu kaufen gibt? Würde da gerne mal einen kurzen Blick reinwerfen.
LikeLike
vorweg: das niveau der auseinandersetzung mit dem thema empfinde ich erfreulich unoffensiv hier.
ich finde, dass die kritiker_innen der inklusiven_gendergerechten sprache (dass man den strich so benutzen kann, habe ich gerade hier gelernt, interessant) erstaunlich aggressiv sind. das kommt immer dann zum ausdruck, wenn die verwender_innen solcher sprache, dies anderen eben nicht aufzwingen wollen, sondern nur selber, für sich und freiwillige rezipient_innen machen, also für sich selber entscheiden. dann werden sie nämlich überraschend häufig sehr scharf angegriffen.
eine solche (leichte) aggressivität (ich meine inhaltlich, soll kein vorwurf an der form der auseinandersetzung sein) findet sich meines erachtens auch hier in einigen kommentaren. zum beispiel wenn gesagt wird, „so ein buch werde ich bestimmt nicht lesen“. da ist dann auf einmal die bereitschaft, die wandelbarkeit der sprache anzuerkennen, ganz verschwunden, während sich nie jemand über auch die bizarrsten überflüssigen anglizismen aufregt (die sind ja auch ausdruck der wandelbarkeit der sprache und oft überhaupt nicht schön). auch papadopoulos‘ vorwurf der aggression wirkt mir da schon wie eine projektion der eigenen negativen gefühle.
der unterstrich beispielsweise soll doch niemanden angreifen oder ausgrenzen, sondern räume schaffen. ich habe ihn aus beruflichen gründen kennengelernt und war sofort begeistert. zur verwendung gezwungen hat mich allerdings keine_r, andere formen der „gendersensiblen“ sprache könnte ich genauso benutzen, was ich auch mache (bis, gar nicht selten, hin zum generischen maskulinum :-). hier lese ich nun gerade zum ersten mal von der „erweiterten“ verwendungsmöglichkeit in be_griffen. ich finde das erstmal einfach wirklich interessant. ein schlichter strich der eine so eine große möglichkeit der erweiterung von wortbedeutungen bietet. natürlich ist das ungewohnt und auch elitär. aber nicht elitärer als der gebrauch von fremdwörtern, fachsprachen etc.
schwierig und auch wichtig zu diskutieren, finde ich aber, was ist, oder wie damit umgegangen werden sollte, wenn die entscheidung, eine solche sprache zu benutzen, nicht nur für sich selber getroffen wird, sondern auch anderen aufgezwungen werden soll. jenseits der strafrechtlichen verfolgbarkeit (z. B. bei rassistischen begriffen) finde ich das problematisch. erstens aus pädagogischen gründen (bringt nichts, wenn die leute das nicht selber wollen) aber auch politisch. wie soll abgegrenzt werden? was ist noch korrekt, was nicht? die landesgleichstellungsgesetze schreiben die beidnennung vor (akademische räte und rätinnen). und sind damit ja total in der binären matrix – reaktionär gewissermaßen. aber den unterstrich verbindlich zu machen, fände ich, trotz eigener begeisterung zu radikal. ich finde, dass es da viel diskussionsbedarf gibt,
LikeLike
@somluswelt 23. April 2013 –
„Sprache beruht einerseits auf Konsens und andererseits ist sie Veränderungen unterworfen. Woher sollen diese Veränderungen kommen, wenn es nicht kreative Versuche gibt, diese vorzuschlagen. Wer meint Sprache würde nicht akiv neugestaltet werden, unterschätzt die historischen Veränderungen, die beispielsweise durch den Buchdruck oder die Übersetzung der Bibel durch Luther stattgefunden haben. “Das Deutsche” oder irgendeine andere Sprache gibt es nicht. “
– „Woher sollen diese Veränderungen kommen, wenn es nicht kreative Versuche gibt,“ – aus den Differenzen, den festgestellten, den Unterschieden, die die Information erst bilden. Jeder festgestellte Unterschied löst eine Bewegung aus, eine Erkenntnisverarbeitung, je mehr davon, um so mehr Bewegung, um so mehr Kreation – anders herum geht es nicht. Das bedeutet im einfachsten Fall einen großen Unterschiedsaustausch (Sprechen …) zu provozieren zur Kreativität
somluswelt, ich teile eine Reihe deiner (später folgenden) Sichten, habe aber auch Fragen:
– Auf welchem „Konsens“ sollte denn „Sprache beruhen“?
Ist es nicht eher so, daß allein feststellbare Unterschiede Information erzeugen und damit den Gegenstand, den du (i.d.R. nur) mit Sprache bezeichnen kannst?
Also: Sprache – „Beruhen“ nicht auf „Konsens“ sondern auf feststellbaren Unterschieden, wenn es den Inhalt betrifft. Geht es um die Funktion und damit um die Form, geht es aus meiner Sicht (anstelle von undifferenzierbarem Konsens) um den (stets am Beginn herzustellenden) „Gemeinsamen Informationsvorrat“, (auch „Unterschiedsvorrat“), der die „Entschlüsselung“ und damit das Verständnis von Sprache sichert
– „unterschätzt die historischen Veränderungen, die beispielsweise durch den Buchdruck oder die Übersetzung der Bibel durch Luther stattgefunden haben. “ Ja, jedoch reicht es bereits, ohne an Buchdruck und Bibelübersetzung zu denken, die Funktion von Sprache auf der Basis der Erkennbarkeit (Wahrnehmung) von Unterschieden und damit der internen „Produktion von Information“ nicht verstanden zu haben bzw. nicht verstehen zu wollen, da erst über diesen Weg (wenn vorhanden und funktionierend) Buchdruck und Übersetzung sich als Transmitter postulieren können.
– “Das Deutsche” oder irgendeine andere Sprache gibt es nicht. “ Diese Behauptung dürfte allerdings arg erklärungsbedürftig sein, gewissermaßen mit einem äußerst dicken Handbuch nur verständlich – wenn überhaupt.
Jede Form von Codierung zur Übermittlung / zum AQustausch erkannter Unterschiede, sprich Informationen, in der Tat JEDE ist eine SPRACHE, daran führt leider kein Weg vorbei. Beweis: Weder du noch ich könnten uns diese Unterschiede so mitteilen, wenn kein „Deutsch“ (als ein Teil des erforderlichen gemeinsamen Informationsvorrates) oder dieses „keine Sprache“ oder überhaupt „keine Sprache die Codierung / Entcodierung ausüben würde, also was soll diese eine Bemerkung „keine Sprache“?
– „Das ist für mich eine Art sich an der Form abzuarbeiten und vom Inhalt abzulenken.“ – das gibt es nicht, nie! Der Inhalt ergibt sich stets erst aus seiner Form, sich an dem einen abzuarbeiten um vom anderen abzulenken ist also eine ertwas laienhafte Vorstellung von Inhalt, Form, vom Ganzen – das erst durch beides erkennbar wird (siehe weiter oben: Sprache)
– „Für mich wird hier keine “Privatsprache” verwendet, sondern die vorhandene Sprache kreativ verwendet, um Verwerfungen und Diskrepanzen sichtbar zu machen. “ – Also nun doch „Sprache“, eventuell auch „Deutsch“, die von dir hier gewählte??
– Aber: „Da Sprache als “Herrschaftsinstrument” es oft den “Marginalisierten” unmöglich macht, zu sprechen.“ RICHTIG!
Wenn der erforderliche GEMEINSAME iNFORMATIONSVORRAT den Marginalisierten (z.B. wissentlich und gezielt) vorenthalten wird, womit wir bei den Bildungs- und Erziehungsfragen wären, die Queer gleichermaßen wie alle anderen betreffen, im Besonderen einen Queer-Feminisnus.
Wobei sich mit großer Wahrscheinlichkeit berechtigt die Frage stellen läßt, ob Queer-Feminismus für sein Selbsverständnis unbedingt einen „eigenen separierten gemeinsamen Invormationsvorrat“ bedarf oder das besser mit dem allgemeinen erfolgen kann … („… die vorhandene Sprache kreativ verwendet …)
LikeLike
„Es fällt mir auf, dass im queer_feministischen Kontext die Kritiker_innen* besonders stark auf sprachliche Veränderungen reagieren. Das ist für mich eine Art sich an der Form abzuarbeiten und vom Inhalt abzulenken.“
Manchmal stimmt das. Das ist aber in diesem konkreten Fall eine unberechtigte Unterstellung, meine ich. Wenn ein anderer Autor oder eine andere Autorin (auch: fern des q*ueEr_feminist*Isch-en Zu-Samm-en-HaNgS) in dieser Häufung, ähm, sprachkreativ schreibt, dann wird das ganz sicher ebenfalls kritisiert! In dieser Häufung stört es einfach. Die meisten Leser/innen sind sprachkonservativ und sie möchten – zumal bei Sachbüchern, dass diese von Autorinnenseite so geschrieben werden, dass die Leser das Gemeinte schnell, bequem und gut auffassen können.
Es ist meiner Meinung nach etwas anderes, wenn eine Autorin ein einzelnes Wort oder ein übersichtliche Anzahl von neuen Schreibweisen verwendet. Oder wenn dies wie in diesem Buch hochinflationär geschieht….
Ich bezweifele dann auch dein sehr freundlich vorgetragenes Argument, dass diese Schreibweisen in Wesentlichen genau dadurch begründet seien, dass nur in dieser neuen Schreibweise der jeweilige Gedanke aus einer Marginalisiertenperspektive erfolgreich formuliert und vermittelt werden könnte.
Ganz ernsthaft: Ich will mir nicht vorstellen, wie die berühmte Rede „I have a dream“ in Lantzschi-Schriftform und -Diktion formuliert werden würde. Verständlicher würde diese Rede damit jedenfalls nicht werden…
LikeLike