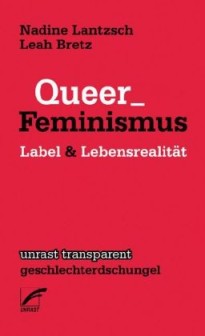 Leah Bretz und Nadine Lantzsch haben ein kleines, sehr lesenswertes Buch geschrieben, in dem sie ihre Praxis des Queer-Feminismus erläutern. Lesenswert fand ich es vor allem deshalb, weil sie dabei das machen, was meiner Meinung nach die Stärke feministischer Politik ausmacht: Sie gehen von sich selbst und ihren eigenen Erfahrungen aus, machen ihre Überlegungen nachvollziehbar, zeichnen die Debatten nach, in die diese eingebettet sind, beziehen sich auf andere, von denen sie gelernt haben, und kommen dadurch zu neuen Einsichten und Urteilen über die Welt, die sie nun wiederum mit anderen teilen.
Leah Bretz und Nadine Lantzsch haben ein kleines, sehr lesenswertes Buch geschrieben, in dem sie ihre Praxis des Queer-Feminismus erläutern. Lesenswert fand ich es vor allem deshalb, weil sie dabei das machen, was meiner Meinung nach die Stärke feministischer Politik ausmacht: Sie gehen von sich selbst und ihren eigenen Erfahrungen aus, machen ihre Überlegungen nachvollziehbar, zeichnen die Debatten nach, in die diese eingebettet sind, beziehen sich auf andere, von denen sie gelernt haben, und kommen dadurch zu neuen Einsichten und Urteilen über die Welt, die sie nun wiederum mit anderen teilen.
Auch wenn ich selbst mich ja nicht als queer verstehe, habe ich bei der Lektüre vieles verstanden und gelernt, was ich in den oft eher zerstückelten und schwer in bestimmte Kontexte einzuordnenden Hin und Hers in Blogs oder auf Twitter nur erahnt hatte. Vielleicht ist das „Buch“ als Format der längeren Texte zu einem Thema ja doch nicht ganz ad acta zu legen 🙂
Ein zentrales Anliegen dieses Buches ist die Sprache, die Art und Weise, wie und von wem über Dinge (nicht) gesprochen wird, was gesagt und gehört wird und was nicht. Dass Sprechen und Handeln nicht zweierlei Dinge sind, sondern dass Sprechen eben selbst eine Form des Handelns ist, finde ich auch (ich nenne das im Anschluss an italienische Feministinnen „Arbeit an der symbolischen Ordnung“).
Um etwas Neues zu sagen, das im Rahmen der vorherrschenden symbolischen Ordnung (noch) nicht denkbar und sagbar ist, braucht es auch eine andere Sprache, die Aufmerksamkeit für Formulierungen, die Erfindung neuer Sprachformen und neuer Wörter. „Entmerken“ und „wegnennen“ sind zum Beispiel zwei Wortschöpfungen, von denen ich mir gut vorstellen kann, dass sie in meinen aktiven Sprachgebrauch eingehen, ebenso die Verwendung des Unterstrichs, der hier nicht nur im Sinne des Gender-Gaps (wie bei „Leser_innen“) oder als wandernder Unterstrich („Les_erinnen“) auftritt, sondern auch, um den Sinn von Worten zu erweitern. „Be_deuten“ etwa schreiben die Autorinnen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Bedeutungen eben nicht einfach da sind („Das Wort X bedeutet dies und jenes“), sondern dass sie von den Sprechenden oder Schreibenden gegeben werden: Wir be_deuten Worte, indem wir ihnen durch die Art, wie wir sie verwenden, mit einer Bedeutung ausstatten, zum Beispiel „Frau“ oder „Lesbe“ oder „Liebespaar“).
Vor allem aber wird der Unterstrich in dem Buch dazu verwendet, die Ambivalenz und Mehrdeutigkeit auszudrücken, die in vielen Situationen teilweise_ganz notwendig ist, um bestimmte Dinge mitzudenken_schreiben_merken_w_orten. Anfangs ist das etwas merk_würdig zu lesen, aber nach einigen Seiten war ich „drin“ und es hat mir gefallen.
Besonders interessiert haben mich die Ausführungen zur Praxis, wobei mir beim Lesen klar geworden ist, warum vieles von dem, was die Autorinnen als „Interventionen“ beschreiben, oft auf so heftigen Widerspruch stößt. Eine Intervention, die sie vorschlagen, ist zum Beispiel „umverteilung ohne anerkennung“, was bedeutet, dass Menschen, die in bestimmten Kontexten privilegiert sind, dort notwendige Arbeiten übernehmen, dabei aber die Deutungs- und Definitionshoheit den anderen überlassen und keine Dankbarkeit oder Anerkennung für das, was sie tun, verlangen und bekommen (S. 32). Dahinter steht die traurige Beobachtung, dass selbst in Gruppen, die sich als kritisch, feministisch oder antirassistisch verstehen, die Privilegierteren oft dazu neigen, die Sache zu dominieren, es besser zu wissen als die anderen und so weiter.
Mich hat das von der Struktur her an eine Regel erinnert, die sich die Philosophinnengemeinschaft Diotima gegeben hat, nämlich bei ihren Diskussionen auf alle Zitate von „berühmten Philosophen“ zu verzichten – Chiara Zamboni beschreibt das in diesem Text. Auch hier ging es um einen konkreten Missstand, den die Beteiligten an sich selbst beobachtet hatten, in dem Fall, dass sich ihre Debatten häufig zu einer Ansammlung von „bereits Gedachtem“ entwickelten und sie nur selten ihre wirklich eigenen Gedanken aussprachen oder ihnen Aufmerksamkeit widmeten.
Beide Interventionen sind Vorschläge, in Form einer politischen Praxis, also durch bestimmte Regeln, eingefahrene Muster zu durchbrechen. Es geht nicht darum, universale Gesetze für alle Zeiten und für jeden x-beliebigen Kontext zu postulieren. Selbst gewählte Regeln, die Teil einer politischen Praxis sind, können sich bewähren oder auch nicht, das bleibt zu beobachten. Die Regel der Diotima-Philosophinnen etwa, auf Zitate generell zu verzichten, hatte tatsächlich zur Folge, dass die Diskussionen fruchtbarer und origineller wurden. Als die beteiligten Frauen nach einigen Jahren dermaßen daran gewohnt waren, ihre eigenen Gedanken zu formulieren und ernst zu nehmen, stellten sie fest, dass der absolute Verzicht auf Zitierungen gar nicht mehr nötig war. In anderen Gruppen und Kontexten kann eine solche Verabredung aber immer noch sinnvoll sein.
Dass Debatten über Vorschläge für Interventionen oder politischen Praktiken häufig so aggressiv ablaufen, scheint mir daran zu liegen, dass sie als allgemeingültige Vorschriften miss_verstanden und entsprechend auseinandergepflückt werden. Einwände wie „Sollen Frauen denn niemals mehr Männer zitieren, das ist doch absurd!“ oder „Sollen Weiße_Männer_etc.pp etwa ihre Meinung nicht mehr sagen dürfen, das ist doch absurd!“ gehen aber am Kern der Sache völlig vorbei. Die Frage ist vielmehr, ob zum jetzigen Zeitpunkt und beim gegenwärtigen Stand der Debatte eine solche (durchaus rigide) Regel hilfreich sein könnte, um einen Missstand zu beheben. Ob sie das ist, kann man nie vorher wissen, sondern man muss es erst einmal versuchen, um es herauszufinden. Und wenn andere mit einer Praxis gute Erfahrungen gemacht habe, was spricht dagegen, davon zu lernen – wenn einer an dem Thema wirklich gelegen ist?
Eine andere Sache, die mir beim Lesen im Kopf hängen blieb, ist die Frage, ob es wirklich „keine Welt außerhalb von Machtverhältnissen“ gibt, wie die Autorinnen schreiben (S. 35). Einerseits ja, sicher, denn wir sind unbestreitbar alle jederzeit in Machtverhältnisse verwickelt. Aber diese Machtverhältnisse sind eben nicht alles, wohinein wir verwickelt sind. Wir sind gleichzeitig – oder können es zumindest sein, wenn wir die Praxis vertrauensvoller Beziehungen pflegen – eingebunden in Kontexte, wo wir die Ungleichheit (vor allem, aber nicht nur, zwischen Frauen) zum Hebel für den Austausch von Begehren und Autorität und damit für Veränderung machen können. Dieser Aspekt kam mir in dem Buch etwas zu kurz, schien mir zu defensiv dargestellt, lediglich in seiner Funktion als Schutz und Abwehr gegen Diskriminierungen gewürdigt und nicht als originäre Politik, die die Kraft hat, Neues und Anderes hervorzubringen.
Vielleicht hängt dieser Eindruck damit zusammen, dass ich auch den (De)-Konstruktivismus nicht für die einzige Analysekategorie halte, die für politische Veränderungsprozesse wichtig ist. Die in der Realität bestehenden Machtverhältnisse zu dekonstruieren ist wichtig und unverzichtbar, keine Frage. Aber das, worum es geht, ist meiner Meinung nach nicht nur die Abwehr von Machtverhältnissen und der Abbau von ungerechten Diskriminierungen. Sondern es geht auch darum, „konstruktiv“ (haha) zu sein, also daran arbeiten, was denn an die Stelle der jetzigen Realität treten könnte, wenn die gegebene erst einmal „dekonstruiert ist“.
Ich bin, anders als die Autorinnen, der Ansicht, dass dafür die Orientierung an so etwas wie „der Wahrheit“ letzten Endes doch unverzichtbar ist. Und zwar gerade dann, wenn wir davon ausgehen, dass Politik immer eine pluralistische Angelegenheit ist, weil es nämlich zum Grundwesen der Menschen gehört, verschieden zu sein. Wenn wir aber alle verschieden sind, und es trotzdem am Ende um mehr gehen soll als darum, die eigene Position gegenüber den anderen durchzusetzen, brauchen wir einen Anhaltspunkt, einen Maßstab, an dem sich unsere kontroversen Debatten orientieren können_sollten_müssten.
Die Realität, die von bereits gegebenen Maßstäben, Kategorien und Be_deutungen geprägt ist, kann das nicht sein, da gebe ich den Autorinnen Recht. Aber ich denke, dass es hinter der „Realität“ noch etwas anderes gibt, das ich „das Reale“ nenne, und dass Interventionen_Worte_Stammeleien_Überlegungen_Ideen, die dieses Reale berühren, eine Wirkung entfalten (können), die mehr ist als bloße Macht_Stärke, Überzeugungskraft oder rhetorisches Geschick. Das Reale geht nicht vollständig in der gegebenen Realität auf, und deshalb ist es ein Orientierungspunkt bei dem Versuch, die Realität zu verändern.
Um es an einem Beispiel deutlich zu machen: „körper sind in unserem konstruktivistischen verständnis diskursiv hergestellte projektionsflächen für genderungen_disableisierungen_rassifizierungen“ schreiben die Autorinnen (S. 39), und das stimmt. Das ist die Realität. Aber Körper sind eben mehr als das. Körper sind auch real. Körper existieren, auch jenseits aller Konstruktionen und Zuschreibungen, und diese realen Körper, auch wenn sie niemals vollends „richtig“ be_deutet werden können, sind meiner Ansicht nach ein unverzichtbares Gegenüber, das unser eigenes kritisches Sprechen über Körper quasi beglaubigen kann. Worte und Handlungen, die das Reale berühren, haben eine Qualität von „Wahrheit“, die sie von anderen Worten und Handlungen, die bloße Ansichten und Meinungen sind, unterscheiden – jedenfalls sehe ich das so. Und etwas Analoges gilt auch für alle anderen Angelegenheiten, über die wir kritisch sprechen (möchten).
Leah Bretz, Nadine Lantzsch: Queer-Feminismus. Label und Lebensrealität, Unrast, Münster 2013, 7,80 Euro.

Was meinst du?